Handwerk an der Peripherie – Ungehorsam in der estnischen Designbildung

Es ist eine Frage der Perspektive, was die Peripherie ist. In dem folgenden Gespräch diskutieren Lilo Viehweg und Triin Jerlei über die estnische Designbildung aus der Perspektive des Handwerks an der Peripherie in historischen und zeitgenössischen Kontexten. Die Peripherie wird in diesem Fall als ein spielerischer Gedanke betrachtet und kann mehrere und manchmal widersprüchliche Bedeutungen haben – geopolitisch, designkulturell und diskursiv.
In prominenten westlichen Designbildungsmodellen wie der Arts-and-Crafts-Bewegung oder dem Bauhaus und in deren Historiografien war das Handwerk oft ein entscheidender Faktor in der Argumentation. In der estnischen Designbildung Mitte und Ende des 20. Jahrhunderts dagegen spielten die impliziten Qualitäten und Infrastrukturen des Handwerks eine entscheidende Rolle für die Selbstbehauptung gegenüber den dominierenden Systemen des Kalten Kriegs zwischen dem sowjetischen Imperialismus und der westlichen Vorstellung von einem unendlich weiterwachsenden Fortschritt. Während Estland aus der westlichen und zentraleuropäischen Perspektive seit 1990 ganz im Osten liegt, war es aus der Sicht der Sowjetunion Teil der westlichen Grenzregion. Auf diese Weise liegt Estland von beiden Standpunkten aus betrachtet an der Peripherie. Wird diese Geschichte jedoch aus einer Perspektive erzählt, die Estland in den Mittelpunkt rückt, ergibt sich Raum für eine designkulturelle Selbstbestimmung, bei der die vielfältigen Eigenschaften des Handwerks zum Antrieb eines lebendigen, sanften, ambivalenten Ungehorsams gegenüber dominanten imperialistischen und neoliberalen Machtsystemen werden, zu einem geschickten Umgang mit dem kulturellen Austausch zwischen dem, was gesagt und was getan wird.


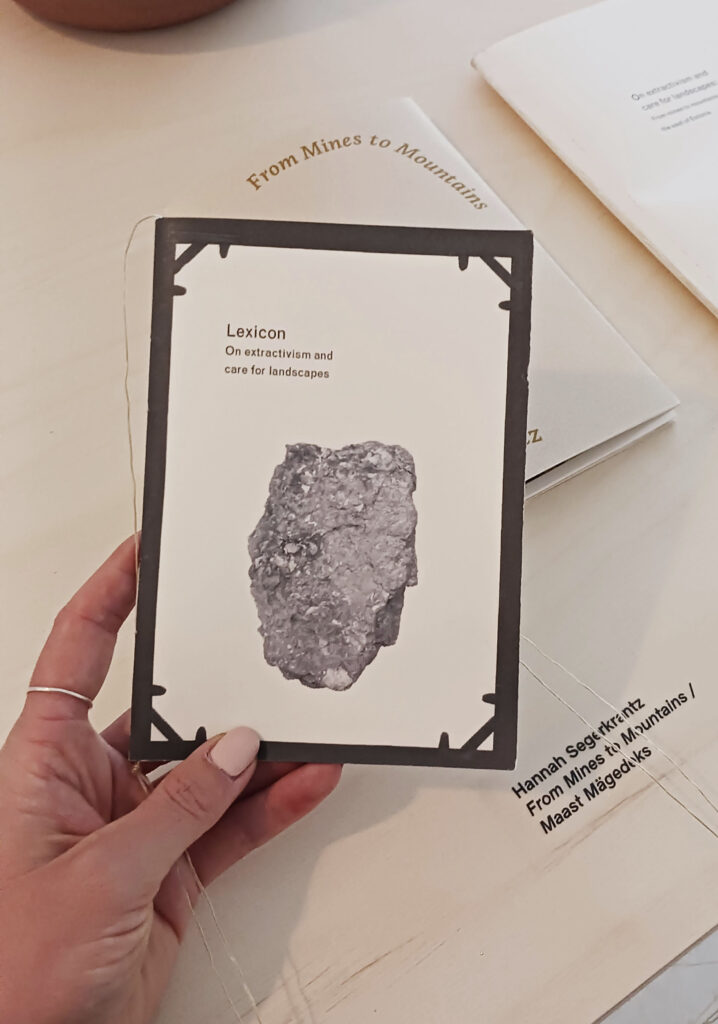

Im Zusammenhang mit der Designbildung ist „Handwerk“ ein ambivalenter Begriff, bei dem es sehr auf den jeweiligen Kontext ankommt. Der Begriff Handwerk impliziert oft die Vorstellung von Geschick oder Fertigkeit. Allerdings wird Handwerk im Zusammenhang mit Design meistens entweder mit der praktischen Arbeit mit Materialien oder als Verweis auf die präindustrielle Produktion benutzt, bei der es dann aber nicht notwendigerweise um eine gewisse Expertise im traditionellen Sinn geht. In einem Gespräch mit Hannah Segerkrantz, die kürzlich ihr Studium an der estnischen Akademie der Künste (EKA) in Tallinn im Studiengang Craft Studies abgeschlossen hat, erzählte sie mir, dass es im Estnischen kein direktes Äquivalent zum englischen craft oder Handwerk gibt. In ihrem Text Taidur-disainer loomeväljal (Künstler-Designer im kreativen Bereich) befasst sie sich mit dieser linguistischen Ambivalenz. Das estnische Wort, das craft am nächsten kommt, aber nicht ganz dasselbe ist, ist taid – wie von den Programmleiter*innen Kärt Ojavee und Juss Heinsalu vorgeschagen –, was sich grob mit „Fertigkeit“, aber auch als „Weisheit“ übersetzen lässt.[1]
Im Hinblick auf die Ziele des Masterstudiengangs und ihren eigenen Forschungsschwerpunkt definiert Hannah Segerkrantz taid genauer. Nach Eik Hermanns dreiteiliger Theorie, nach der Handwerk aus „Beinarbeit, Handarbeit und Kopfarbeit“ besteht, kombiniert der Studiengang ethnografische Feldstudien, Materialexperimente in Workshops und Theoriekurse. Die „Fertigkeiten“, die in diesem Sinn erworben werden, beziehen sich nicht auf die traditionelle Bedeutung von „Handwerk“ in Designkontexten, die nur Wert auf Handarbeit legen. Stattdessen schließen sie auch Denken und kritische Reflexion über Herstellungsprozesse ein.[2] In Hannahs Masterarbeit geht es um Abfallprodukte des Ölschieferabbaus in Ida-Virumaa in Estlands östlichster Grenzregion zu Russland. Sie bewegt sich zwischen der handwerklichen Technik der Keramikglasur aus giftigen Industrieabfällen, Feldstudien in (post-)industriellen Landschaften und dem Studium estnischer Bergbaugeschichten. Dabei positioniert sie „,Handwerk‘ als Werkzeug für eine körperliche und intellektuelle Neuorientierung“.[3] Eine elegante periphere Erkundung – geopolitisch und epistemologisch –, die sich über die konventionellen Definitionen von „Handwerk“ im Designkontext hinwegsetzt. Hier ist „Handwerk“ nicht mehr implizit. Eine kritische Lesart im Hinblick auf materielle Industrien, Arbeit und Fragen zur Ökologie ist genauso relevant.
In deiner Forschung, Triin, blickst du auch auf die Geschichte der tööstuskunst, der industriellen Kunst, die Mitte der 1960er-Jahre im Anschluss an die sowjetischen Tauwetterperiode in Estland etabliert wurde. Damals war das ein neuer Berufszweig, der mit dem Industriedesign im Westen vergleichbar war. Welche Beziehung bestand in dieser Zeit in Estland zwischen der sogenannten industriellen Kunst und dem Handwerk, und welchen Einfluss hatte das auf die Designbildung am Staatlichen Kunstinstitut der Sowjetrepublik Estland/ERKI, der heutigen EKA?

Aus Sicht der sowjetischen Ideologie hatten Handwerk und „industrielle Kunst“ eine sehr einfache und zweckmäßige Beziehung: Das Ziel des Handwerks (oder der angewandten Kunst, wie es im lokalen Kontext genannt wurde) war in den 1960er- und 1970er-Jahren ursprünglich die Bereitstellung von Entwürfen, die für die Massenproduktion tauglich waren. Diese Idee war schon in den 1920er-Jahren an der Moskauer Designschule WChUTEMAS, einer Zeitgenossin des Bauhauses, entstanden. Obwohl die WChUTEMAS-Vorstellungen Estland nicht direkt erreichten, hatte die Verbindung von Industrie und Handwerk im Designdenken der Sowjetunion bereits Gestalt angenommen. Wie Ingi Vaher, eine in der Designpolitik aktive Künstlerin und Handwerkerin, 1964 sagte: „Nur die Industrie kann Produkte der angewandten Kunst in einem solchen Umfang vervielfältigen, dass der Geschmack der breiteren Öffentlichkeit beeinflusst wird.“[4] Und um fair zu sein: Als die damalige Estnische Akademie der Künste 1914 eröffnet wurde, war es ihr erstes Ziel, junge Menschen in „künstlerischem Handwerk“ zu unterrichten. Die schönen Künste kamen erst mit dem Lehrplan von 1951 hinzu, als die Schule mit dem Institut der schönen Künste zusammengelegt wurde, das seinen Sitz zuvor in Tartu hatte. Doch auch wenn die Industrie die Rechtfertigung für die Handwerksausbildung war und Absolventen oft in Fabriken geschickt wurden, waren akademische Projekte doch häufig auch auf einen künstlerischen Schwerpunkt ausgerichtet.
Obwohl in den 1970er-Jahren das Handwerk sein Existenzrecht in Estland[5] für sich behaupten konnte, ohne an die Massenindustrie gebunden zu sein, stand im Zentrum der sowjetischen Ideologie immer noch die Fabrik, und das System war auf die Massenproduktion ausgerichtet. In den 1950er-Jahren wurden Kunst und „angewandte Kunst“ zu Waffen der Propaganda in der ganzen Sowjetunion, wie sich zum Beispiel an den vielen Vasen erkennen lässt, die mit Stalins Porträt geschmückt waren. Ein Objekt war einfach eine Fläche für eine Dekoration. Doch als schließlich der imperiale neoklassizistische Stil durch die rationale Moderne der späten 1950er-Jahre ersetzt wurde, war die „angewandte Kunst“ plötzlich nicht mehr als Propagandawaffe zu gebrauchen. Sie war ein unbequemes Nebenprodukt der modernen, zweckgebundenen Massenproduktion, und man sagte ihr „gefährliche“ individualistische Konnotationen nach. Design konnte als Versprechen eines besseren Morgen eingesetzt werden, als Nachahmung des westlichen Konsumerismus (obwohl sich das estnische Design und die „industrielle Kunst“ gleichermaßen gegen diese Aufgabe auflehnten). Im Handwerk fand sich ein Element der Subversion, obwohl es mehrere soziale Experimente gab, mit denen die sowjetische Kontrolle in Schach gehalten werden sollte. So wurden Handwerker in „Kunstproduktionsfabriken“ organisiert, um ihrer Praxis eine fabrikartige Dimension kollektiver Kontrolle zu verleihen. Dass es so schwierig in die Propaganda einzufügen war, verschaffte dem Handwerk im sowjetischen Estland eine Blütezeit. So wird zum Beispiel berichtet, einige angehende Maler und andere Künstler hätten sich entschieden, anstelle der schönen Künste handwerkliche Fächer zu studieren, denn es war bekannt, dass die Zensur dort weniger streng war. Der Maler Jüri Arrak zum Beispiel, der für seine semiabstrakten menschlichen Figuren berühmt ist, hat von 1961 bis 1966 ein Studium der Metallarbeit absolviert.
Es sollte auch betont werden, dass der Begriff Handwerk in der zeitgenössischen estnischen Kunst- und Designterminologie sehr locker gebraucht wird, und ich würde behaupten, dass er bis heute keine feste Identität hat und eher ein gemeinsamer Nenner ist, der sich auf Praktiken anwenden lässt, die andernfalls Kunst oder Design genannt werden. Diese fluide Identität erlaubt Flexibilität in Communitys und in der Praxis.

Ja, und sieht man sich die Geschichte der estnischen Designbildung an, so wurde darin das Handwerk nicht immer explizit unter so heterogenen Aspekten diskutiert, wie Hannah Segerkrantz in ihrem Beispiel zeigt. Ihre Forschungen über die Arbeit Ingi Vahers für das Tööstuskunsti komitee (Komitee für industrielle Kunst) in den 1960er-Jahren zeigt,[6] wie die estnische Kunsthandwerkskultur (Glas und Textilien, die zu dieser Zeit vor allem von Designerinnen ausgeführt wurden) in einer ungenau definierten Designpolitik ihren Weg durch die Geschichte finden konnte – nicht ohne Zwiespalt, aber doch jenseits des dominanten imperialistischen Einflusses des Kalten Kriegs. In dem, was du einen Fall von „peripherer ‚Designorganisation‘“[7] nennst, war es möglich, Entwürfe zu unterstützen, die nicht für das Militär oder den Maschinenbau bestimmt waren, die zum Beispiel besonders vom in der gesamten Sowjetunion aktiven Institut WNIITE (Allsowjetisches wissenschaftliches Institut für technische Ästhetik) gefördert wurden. Eine Designpräferenz, die meines Erachtens in diesem Kontext den zu jener Zeit im Westen vorherrschenden Industriedesignkonzepten ähnelt, etwa denen des Massachusetts Institute of Technology in Boston. Warum war es möglich, dass die Handwerkskultur zu einer treibenden Kraft für eine Art ambivalenten Ungehorsam gegen die totalitäre Dominanz in Estland wurde?
Ich glaube, dass das Handwerk bis zu einem gewissen Grad schwieriger zu kontrollieren ist, denn es widersetzt sich Kategorisierungen und ist daher schwer zu definieren. Sowohl Mitte des 20. Jahrhunderts als auch im aktuellen Kontext gibt es Objekte, Kategorien und Künstler, die zwar mit sehr unterschiedlichen Materialien, Absichten und Produktionsweisen arbeiten, die sich aber im selben Bereich des Handwerks bewegen. Der Totalitarismus bevorzugt einfache und unbestrittene Definitionen und hat Probleme mit den peripheren Bereichen.
Ich versuche immer wieder, ein gutes Beispiel für subversive Praktiken gegen die Sowjetunion zu finden … und ich scheitere jedes Mal. Denn zur Realität des Handwerks in totalitären Systemen gehört, dass es gemessen an heutigen Standards meistens nicht sichtbar subversiv ist. Die Subversion findet sich in dem, was nicht da ist, was wir nicht in Archiven finden. Es ist schwierig, antitotalitäre Arbeiten in Universitätsarchiven zu entdecken. Sie wären nicht aufbewahrt worden.
Wir müssen uns auch daran erinnern, dass es kein Studium zur Ausbildung von Künstlern im heutigen Sinn gab, das auf einem Handwerk beruhte. Das Studium sollte Künstler auf Fabriken und ähnliche Arbeitsplätze vorbereiten. Dennoch erinnert sich zum Beispiel die Glaskünstlerin Maie-Ann Raun daran, dass während ihres Glasstudiums von 1958 bis 1964 der Schwerpunkt immer noch auf der künstlerischen Produktion lag. In unserer heutigen neoliberalen Kultur würden wir das als Unvermögen bezeichnen, die Anforderungen des Arbeitsmarkts zu erfüllen. Aber könnten wir das nicht auch als Subversion definieren?

Genau. Arbeitsmarkttauglichkeit ist eines der Argumente des neoliberalen Denkens in der Bildung. Doch diese Top-down-Marktlogik lässt die Wirkmacht der Studierenden außer Acht, die sich Design anders vorstellen. Ähnlich wie zur Zeit der Sowjetunion können wir heute beobachten, wie man sich in der estnischen Designausbildung seit den 1990er-Jahren zwischen den Systemen und den Vorstellungen von Ungehorsam gegenüber dominanten Designkulturen mittels Materialerkundung, Handwerk und Improvisation durchnavigiert. Das wird zum Beispiel in den Gegenbewegungen zur Neoliberalisierung der Designausbildung deutlich, wie sie etwa in Texten von Mart Kalm[8] und Maarin Ektermann[9] beschrieben werden, zeigt sich aber auch in vielen dokumentierten Studierendenarbeiten. Als ich im Sommer 2025 die Ausstellung der EKA-Absolvent*innen besuchte, sah ich viele Projekte, die einen poetischen, verspielten und humorvollen Ungehorsam gegenüber den beschriebenen autoritären Systemen zeigten. Wie würdest du die derzeitige Designkultur an der EKA im Verhältnis zu den Handwerksgeschichten beschreiben, die wir bereits diskutiert haben?

Was in der EKA vielleicht noch immer besteht, ist die Materialität, denn Werkstätten und der Unterricht mittels praktischem Arbeiten haben immer noch einen hohen Stellenwert. Wo Kunst- und Designstudierende vor Jahrzehnten auf den Zugang zu verschiedenen Materialien angewiesen und in Estland oft nicht einmal hochwertige Bleistifte zu haben waren, hängen die heutigen Studierenden von Geld ab. Digitale Tools erlauben zwar eine Kostenreduzierung, aber man kann Materialien nicht wirklich kennen, ohne mit ihnen zu arbeiten. Hier würde ich behaupten, dass die traditionelle Ausrichtung der Design- und Kunstausbildung in der sowjetischen Ära für die heutigen künstlerisch tätigen Handwerker von Vorteil war. Wo moderne digitale Tools in der Ausbildung später zugänglich wurden, hielten sich gewisse Traditionen lange genug, um noch zu bestehen, als auf globaler Ebene der Neuheitswert der Digitalität schon eine postdigitale kritische Dimension annahm. 2014 schrieb Kadri Mälk, Leiterin der Abteilung Schmuck und Schmiedearbeiten: „Indem man das schätzt, was woanders verschwindet oder was dort nie existiert hat, erweisen wir der Zukunft einen Dienst … Was soll man mit diesem Wissen anfangen? Ich glaube – wir sollten dem besessenen Streben nach Erfolg, das wir in der Welt und auch in Estland sehen, Einhalt gebieten.“[10]
Heutige estnische Studierende und Künstler*innen, die mit Materialien wie Glas, Keramik, Metall und anderem mehr arbeiten, die traditionell dem Handwerk zugerechnet werden, haben die Freiheit, ihren Protest verbal und visuell auszudrücken, wohingegen ihre Kolleg*innen in totalitären Systemen auf Doppeldeutigkeiten zurückgreifen müssen. In gewisser Weise gibt es verschiedene Handwerksarbeiten aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, die die Natur als visuellen Bezugspunkt nutzten, als unterschwelligen Protest gegen die Technokratie der Moderne. Bruno Tomberg, Gründer des Fachbereichs Industriedesign in den 1960er-Jahren, entwarf nachbaubare Gartenstühle für die Allgemeinheit, weil es keine entsprechenden Produkte aus der Massenproduktion gab. Wir können sie aber auch als Widerstand gegen die Industrieproduktion und die Umweltschäden betrachten, die sie anrichtete. An dieser Stelle ist es vielleicht gut, sich daran zu erinnern, dass die Bedeutung einer Arbeit nicht nur vom Handwerker oder der Handwerkerin abhängt, sondern auch von den Betrachter*innen.
Dass sich die Grenzen zwischen den verschiedenen Bereichen auflösen, hat der zeitgenössischen Handwerkskultur geholfen, sich im Vergleich zu den rigiden totalitären Klassifizierungen zu diversifizieren. Darum ist es auch gut zu sehen, dass sich die heutigen Arbeitsfelder noch immer rigiden Kategorisierungen und Labels verweigern.

Ja, und in diesem Sinn kann das Handwerk in peripheren Sphären – in der Praxis wie im Diskurs – uns lehren, wie wir mit Ungehorsam gegenüber Totalitarismus umgehen. Ich danke dir für das Gespräch, Triin.

Dr. Triin Jerlei ist Associate Professor für Designtheorie und -geschichte im Fachbereich Produktdesign der Estnischen Kunstakademie sowie Researcherin an der Kunstakademie Vilnius im Rahmen der Initiative Neues Europäisches Bauhaus. Zu ihren Forschungsthemen gehören sowjetische und postsowjetische Designökonomien und transnationale Verbindungen im Design des 20. Jahrhunderts. Sie kuratierte mehrere Ausstellungen über estnisches und baltisches Design, verfasst Beiträge für wissenschaftliche Journale, Magazine und gibt Bücher heraus. • Lilo Viehweg ist eine Forscherin, Kuratorin und Pädagogin mit einem Hintergrund in Industriedesign und Cultural Studies. In ihrer Arbeit untersucht sie kritische Historiografien materialbasierter Designprozesse, die Hierarchien der Wissensproduktion und die damit verbundenen soziopolitischen Bedingungen des Designs. Sie unterrichtet Designforschung und -geschichte und entwickelt Formate für den kollektiven Austausch innerhalb und außerhalb der akademischen Welt. Darüber hinaus promoviert sie zurzeit im Programm Make/Sense an der Hochschule für Kunst und Gestaltung Basel und an der Kunstuniversität Linz.